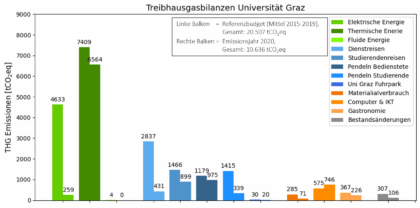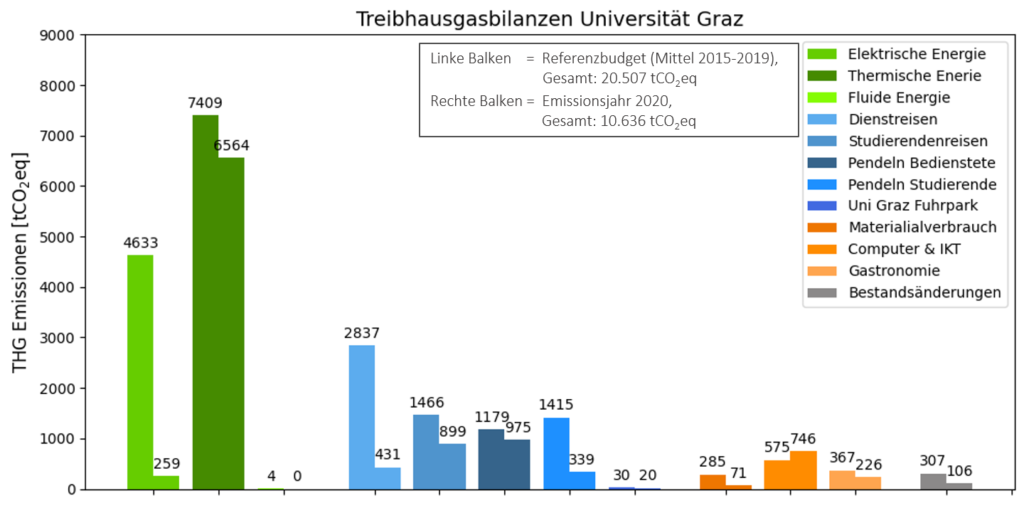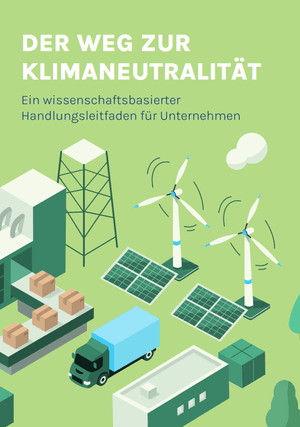Professur „Transformative Nachhaltigkeitsforschung“ an der BOKU University ausgeschrieben
An der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) ist ab 1. März 2026 eine Professur für Transformative
Nachhaltigkeitswissenschaften zu besetzen. Die Stelle wird gemäß § 98 Universitätsgesetz 2002 in
Form eines zeitlich unbefristeten vertraglichen Dienstverhältnisses besetzt: Ausschreibung einer Universitätsprofessur für Transformative Nachhaltigkeitswissenschaften
Eng: Call for applications for the position of a Full Professor of Transformative Sustainability Sciences
Leitfaden Klimaneutralität für Unternehmen – CCCA
Das CCCA hat einen Leitfaden zur Erreichung von Klimaneutralität speziell für Unternehmen herausgegeben. Auch für Universitäten und Hochschulen kann dieser hilfreich sein.
Den Leitfaden finden Sie hier: Leitfaden_Klimaneutralitaet.pdf
Job: Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in ohne Doktorat im Forschungs- und Lehrbetrieb
An der BOKU ist derzeit eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeit ausgeschrieben. Unter anderem ist diese Stelle auch für die Leitung der AG BNE der Allianz zuständig.
Interessierte Bewerber*innen sind aufgerufen sich bis 2.6. zu bewerben!
Medizinische Universität Wien tritt der Allianz bei
Die Allianz Nachhaltige Universitäten in Österreich wurde vor mehr als 10 Jahren als informelles Netzwerk gegründet, um Nachhaltigkeitsthemen stärker an den Universitäten zu verankern. Inzwischen sind 20 der 23 öffentlichen Universitäten Österreichs Mitglied der Allianz.
Zuletzt ist 2024 die Medizinische Universität Wien beigetreten. Damit wird die Kompetenz in Bezug auf die Transformation von Medizinischen Universitäten in Österreich in Richtung Nachhaltigkeit weiter verstärkt. Die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding[1] (s. Foto), als gemeinsame Basis der Zusammenarbeit in der Allianz, ist sichtbares Zeichen der Mitgliedschaft und wurde im April 2025 von Vizerektorin Fritz der Medizinischen Universität Wien unterzeichnet.

Mit der Gründung der Task Force „Green University“ am 2. April 2024 sowie spezialisierter Arbeitsgruppen für Lehre, Research & Community und Bau & Beschaffung setzt die Medizinische Universität Wien gezielt neue Schwerpunkte für eine nachhaltige Entwicklung. Zusätzlich unterstreicht der Beitritt zur Allianz Nachhaltiger Universitäten Österreichs im Jahr 2024 das klare Bekenntnis zur Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Durch die Stärkung von Nachhaltigkeit in Lehre, Forschung, Beschaffung und Bau sowie durch den Ausbau des Wissensaustauschs, die Sichtbarmachung erfolgreicher Initiativen und die enge Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum AKH Wien und Partneruniversitäten treibt die Medizinische Universität Wien ihre Vision einer zukunftsfähigen Medizin entschlossen voran.
Die Allianzuniversitäten sowie die Expert*innengruppe freuen sich über die neuen Sichtweisen und Kompetenzen, die nun durch die Meduni Wien eingebracht werden. Eine Übersicht über alle Allianzuniversitäten und den jeweiligen Ansprechpersonen finden Sie hier: Allianzuniversitäten – nachhaltigeuniversitaeten.at
[1] Memorandum of Understanding – nachhaltigeuniversitaeten.at [Abfrage am 9.4.2025]